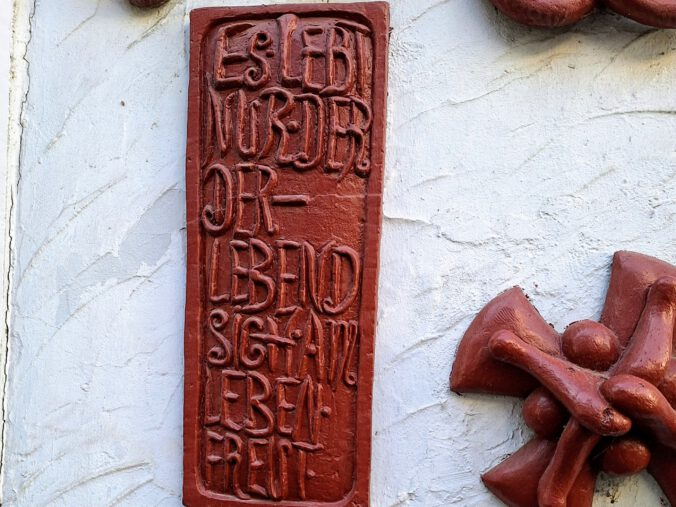Ein Weihnachtspäckchen aus Berlin war der Anstoß: 2 Bücher über das Hirschberger Tal, dem schlesischen Elysium, eine Landkarte und der Weihnachtswunsch, man könne doch 2022 gemeinsam einen Wanderurlaub dort verbringen. Garniert wurde die Idee noch damit, dass man dann in einigen der dort als Hotels genutzten Schlössern übernachten könne. Letzteres gab den Ausschlag, dass ich mit Schwägerin und Schwager im Spätsommer von Berlin über die polnische Grenze fahre.
Ich hatte vor Weihnachten 2021 noch nie etwas von diesem Tal in Niederschlesien gehört. Der Talkessel mit seinem namensgebenden Zentrum Jelina Gora (Hirschberg) wird flankiert vom Riesengebirge.
Das weckt einige wenige Assoziationen: Schneegebirge, Rübezahl….
Dass das Tal die höchste Dichte an Schlössern, Herrenhäusern und Parks in Europa hat, war mir aber unbekannt. Dabei ist diese mitteleuropäische Kulturlandschaftbereits im 18. Jahrhundert bereits ein Anziehungspunkt. Nachdem das bis dahin habsburgische Schlesien von Friedrich II eingenommen worden war, baute zuerst der Adel, danach auch das reiche Bürgertum dort – bei den „Preußischen Alpen“ – seine hochherrschaftlichen Residenzen und Parklandschaften. Und auch Künstler:innen entdeckten das Tal alsbald: Natürlich war Goethe hier, aber auch E.T.A. Hoffmann, Alexander von Humboldt, Körner, Fontane, Caspar David Friedrich und, und, und. „Es ist der große Vorzug der schlesischen Bäder“, schreibt Josef Roth 1925, „dass sie jedes Bedürfnis an falscher und echter Romantik, an ‚Abgeschiedenheit ‚, an Bergen, Wald und Andacht befriedigen und noch viel für den verwöhnten Zivilisationsmenschen übrig haben“.

Und noch ein Name ist mit dem Tal verbunden: Gerhart Hauptmann, der in Agnetendorf/Jagniatkow lebte und starb und der den schlesischen Webern ein literarisches Denkmal setzte. Wobei wir bei denen wären, die das „siebentorige Theben“ bauten. Der Reichtum der häufig bürgerlichen Schlossherren, der „Schleierherren“, der Kaufleute, die den Leinenstoff in ganz Europa vertrieben, der gründete auf einem System der Ausbeutung der „Häusler“, die das Garn herstellten und den Stoff webten, die beim Verkauf auf Gedeih und Verderb abhängig waren von den Zwischenhändlern und den reichen Endabnehmern. Die zu allem noch den Weberzins an den Grundherrn zahlen mussten.
Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch –
Wir weben, wir weben. (Heinrich Heine)
Ich bin gespannt – auf das Tal, auf das Riesengebirge, auf Schlösser und Kurbäder – und vielleicht auf eine Begegnung mit Rübezahl.

















 Nach dem Krieg wurde das Paulinum zu einem der größten Lager geraubter und wiedergefundener polnischer Kunstschätze. Später war es Offizierskasino der polnischen Armee. Nach einem Brand und dem Wiederaufbau wurde es 2002 von einer eigens gegründeten Paulinum-Gesellschaft renoviert und zu einem Hotel umgestaltet.
Nach dem Krieg wurde das Paulinum zu einem der größten Lager geraubter und wiedergefundener polnischer Kunstschätze. Später war es Offizierskasino der polnischen Armee. Nach einem Brand und dem Wiederaufbau wurde es 2002 von einer eigens gegründeten Paulinum-Gesellschaft renoviert und zu einem Hotel umgestaltet.








 Wer wie wir zur Kirche wandern will, braucht etwas Kondition. Zuerst geht es noch sanft ansteigend an der Lomnitza entlang, aber dann schwitzt man schnaufend die Strasse in engen steilen Kehren hoch. Es lohnt die Mühe.
Wer wie wir zur Kirche wandern will, braucht etwas Kondition. Zuerst geht es noch sanft ansteigend an der Lomnitza entlang, aber dann schwitzt man schnaufend die Strasse in engen steilen Kehren hoch. Es lohnt die Mühe.