
Auch das gibt es: mutwillig zerstörte Informationstafeln zum Grünen Band und dem Naturschutz. Gesehen oberhalb von Meilschnitz.
Ich war durch den Wanderführer vorgewarnt: Der Kolonnenweg bei Meilschnitz sei sehr steil. Und das war nicht übertrieben. Obwohl es noch früher Morgen ist, schwitze ich aus allen Poren. Ich kann mir kaum vorstellen , dass hier Fahrzeuge hoch kommen. Na ja, Militärfahrzeuge wohl schon.
Dabei ist der Weg durch den Wald toll. Ganz still ist es. Über mir, gar nicht hoch, kreist ein Raubvogel. Ein Reh springt über den Weg. Das dritte bisher auf der gesamten Tour.
Oben am Isaak liegt der „Generalsblick“. Hierher führten DDR-Grenzoffiziere ausländische Militärs hin, um ihnen die „perfekte Grenze“ zu zeigen. Heute habe ich einen wunderbaren Ausblick über die Bäume bis nach Sonneberg.
Dann geht’s weiter hoch bis zur Straße. Und dann kommen die Bremsen (pfälzisch). Nichts hält sie ab. Obwohl ich mit Mückenspray eingerieben bin, finden Sie immer noch einen Platz zum Zustechen.
Ich verlasse fluchtartig den Platz und laufe auf der gegenüberliegenden Seite Kolonne weiter. Am Waldrand jetzt rechts Felder, Birken säumen den Weg, dann geht’s wieder rein in den Wald, immer schön auf einer Höhe – und dann ist der Weg weg. Ich erahne noch, wo es lang gehen könnte, merke aber, dass alles keinen Zweck hat. Einen kleinen Pfad gehe ich ein paar Meter ins Dickicht, gebe aber auch das bald auf. Auf den Infotafeln am Wegrand, wird immer wieder vor Minen gewarnt, die möglicherweise noch im Boden liegen. Da habe ich viel zu sehr Schiss.
Also Kehrtwende und alles wieder zurück, die Straße erst runter nach Effelder und wieder hoch nach Rückerswind. In Effelder bestätigt man mir, dass ich durchaus richtig war. Und Minen gibt’s hier nicht mehr. „Wir gehen dort oben ja auch in die Pilze und in die Beeren!“
Dann ist es aber ein schöner Weg ins Tal der Effelder, weiter durch den Talgrund bis zum Froschgrundstausee, der von der gigantischen ICE-Brücke der Strecke Nürnberg – Berlin überspannt wird. Und: In einem Restaurant am See gibt’s gutes Essen.
 In Weißenbrunn hoch über dem Stausee tut mir der Wasserfall nicht den Gefallen: Es gibt kein schönes Foto, weil das Wasser fehlt. Also auf nach Almerswind und dann noch mal 2,5 Kilometer bis Schalkau. Das erste Mal spüre ich die gelaufenen Kilometer. Es war ein sehr heißer Tag. Und durch den Umweg habe ich zwar 29 Kilometer, aber keine „Strecke gemacht“.
In Weißenbrunn hoch über dem Stausee tut mir der Wasserfall nicht den Gefallen: Es gibt kein schönes Foto, weil das Wasser fehlt. Also auf nach Almerswind und dann noch mal 2,5 Kilometer bis Schalkau. Das erste Mal spüre ich die gelaufenen Kilometer. Es war ein sehr heißer Tag. Und durch den Umweg habe ich zwar 29 Kilometer, aber keine „Strecke gemacht“.


 Mein Höhepunkt war aber die Kinderabteilung im Untergeschoss: Riesengroße Glasvitrinen, eigentlich Puppenbühnen hinter Glas. Darin dreidimensionale Wimmelbilder mit Puppen. Von Dornröschen, von einem Zoo oder von Wilhelm Buschs „Max und Moritz“. Am allerschönsten sind aber die Vitrinen, die die verschiedenen Berufsbilder innerhalb des Puppenmacherhandwerks zeigen: Der Bossierer, der Drücker, der Puppenstopfer, der Puppenkopfmaler, der Augeneinsetzer, der Puppenfriseur…..
Mein Höhepunkt war aber die Kinderabteilung im Untergeschoss: Riesengroße Glasvitrinen, eigentlich Puppenbühnen hinter Glas. Darin dreidimensionale Wimmelbilder mit Puppen. Von Dornröschen, von einem Zoo oder von Wilhelm Buschs „Max und Moritz“. Am allerschönsten sind aber die Vitrinen, die die verschiedenen Berufsbilder innerhalb des Puppenmacherhandwerks zeigen: Der Bossierer, der Drücker, der Puppenstopfer, der Puppenkopfmaler, der Augeneinsetzer, der Puppenfriseur…..
 10 Tage sind wir nun zu einem großen Teil auf dem Kolonnenweg gewandert. Langweilig? Immer gleich? Mitnichten. Zwar ist der Aufbau meist identisch. Links und rechts ausgelegte Betonplatten mit Lochmuster, sehr verwitterungsbeständig. In der Mitte ein freigelassene Streifen Bodengrund – nicht immer gleich breit. Grenzfahrzeuge konnten – sogar mit einer Art Militär-T rabi – jeden Punkt der Grenze erreichen.
10 Tage sind wir nun zu einem großen Teil auf dem Kolonnenweg gewandert. Langweilig? Immer gleich? Mitnichten. Zwar ist der Aufbau meist identisch. Links und rechts ausgelegte Betonplatten mit Lochmuster, sehr verwitterungsbeständig. In der Mitte ein freigelassene Streifen Bodengrund – nicht immer gleich breit. Grenzfahrzeuge konnten – sogar mit einer Art Militär-T rabi – jeden Punkt der Grenze erreichen.


 Was sich manchmal alles in einen Tag hineinpackt:
Was sich manchmal alles in einen Tag hineinpackt:

 Es ist früher Sonntagmorgen, als wir von Spechtsbrunn aus über einen Wiesenweg hinauf zum Waldrand steigen. Dort finden wir bald wieder den Kolonnenweg. Und wir finden die Hinweisschilder über junge Menschen, die bei Fluchtversuchen erschossen worden sind. Hier waren es drei Menschen, vor Spechtsbrunn zwei. Abends sagte mir ein Besucher in der Gastwirtschaft: Hier ist nichts passiert. Nur einer ist mal erschossen worden. Das ist alles in Berlin gewesen.“
Es ist früher Sonntagmorgen, als wir von Spechtsbrunn aus über einen Wiesenweg hinauf zum Waldrand steigen. Dort finden wir bald wieder den Kolonnenweg. Und wir finden die Hinweisschilder über junge Menschen, die bei Fluchtversuchen erschossen worden sind. Hier waren es drei Menschen, vor Spechtsbrunn zwei. Abends sagte mir ein Besucher in der Gastwirtschaft: Hier ist nichts passiert. Nur einer ist mal erschossen worden. Das ist alles in Berlin gewesen.“



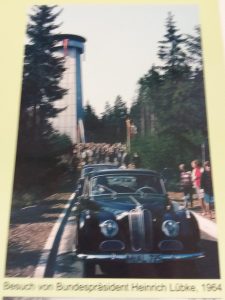



 Überall in den kleine Dörfern links und rechts des Grünen Bandes gab es früher Gasthäuser und Pensionen. Jetzt treffen wir unterwegs kaum auf eine Einkehrmöglichkeit. Häufig findet man am Ortseingang noch ein Hinweisschild mit Öffnungszeiten – aber nur, weil man vergessen hat, es abzumontieren.
Überall in den kleine Dörfern links und rechts des Grünen Bandes gab es früher Gasthäuser und Pensionen. Jetzt treffen wir unterwegs kaum auf eine Einkehrmöglichkeit. Häufig findet man am Ortseingang noch ein Hinweisschild mit Öffnungszeiten – aber nur, weil man vergessen hat, es abzumontieren. In den Gaststätten selbst ist die Zeit stehen geblieben. Das Interieur aus den 60er Jahren, viel Holz, eine Schiebetür für den zweiten Gastraum, alles im Halbdunkel – ich habe sogar den guten alten Kaugummi-Automaten wiederentdeckt. Die Speisekarte stammt auch aus den 60ern: Strammer Max und Toast Hawaii. Frische Klöße gibt es – wenn überhaupt – nur an Wochenenden und auf Bestellung.
In den Gaststätten selbst ist die Zeit stehen geblieben. Das Interieur aus den 60er Jahren, viel Holz, eine Schiebetür für den zweiten Gastraum, alles im Halbdunkel – ich habe sogar den guten alten Kaugummi-Automaten wiederentdeckt. Die Speisekarte stammt auch aus den 60ern: Strammer Max und Toast Hawaii. Frische Klöße gibt es – wenn überhaupt – nur an Wochenenden und auf Bestellung. Das
Das 


