 Was sich manchmal alles in einen Tag hineinpackt:
Was sich manchmal alles in einen Tag hineinpackt:
Da war zuerst einmal der Abschied von Annette, die in Pressig die Tour beendet und dort noch einen Tag bei ihrer Freundin bleibt. Danke, liebe Annette, für die Begleitung! Dein Orientierungssinn wird mir fehlen. Und ab heute werde ich den Rucksack jedes Mal wieder selbst runter nehmen müssen, wenn ich fotografieren will.
Annettes Freundin – danke, liebe Sigrun, für deine Gastfreundschaft, für deine gedanklichen „Stolpersteine“ und die Fahrten zu DEINEM schönen Frankenwald – hat mich zum Start der heutigen Etappe gefahren.
Dort – und damit bin ich beim zweiten Paket des Tages, standen schon Wagen des Bayerischen Rundfunks. Sie wollten mit Kai Frobl, BUND-Experte und „Erfinder“ des Namens „Grünes Band“, einen Beitrag für die Frankenschau drehen. Und dann kam ich dahergelaufen. Das war natürlich ein wunderbarer Zufall, wie es kein Drehbuch besser schreiben kann. Der Beitrag läuft Ende Juli. Ich bin mit dabei: verschwitzt, mit ungewaschenen Haaren, Sonnenbrille, die ich vergaß abzunehmen…..
Aber trotzdem war es schön.
Und ich freue mich, wenn viele meiner Leser und Leserinnen etwas zur Erhaltung, Weiterentwicklung und Pflege des Grünen Bandes spenden.

Das Dritte Päckchen des Tages war dann eine Auenlandschaft bei Neustadt. Ich bin gerade auf dem Radweg an der Steinach unterwegs, denke, dass Radwege für die Wandrerin nicht gerade das Non-plus-Ultra sind, als ich den Kolonnenweg entdecke, der über eine Brücke führt. Die Steinach hatte die DDR-Grenztruppe begradigt. Nach der Wende hat sich das Flüsschen sein altes Bett geholt, und so ist eine Aueninsel entstanden: ein kleiner Urwald. Der Kolonnenweg ist hier so gut wie zugewachsen. Brenessel, Brombeeren, Windbruch von Birken und Pappeln – man muss schon einiges bewältigen. Aber es macht Spaß, so sehr, dass ich den Weg immer weitergehe und irgendwann an der Straße Neustadt – Sonneberg herauskomme. Dann muss ich zwar durch ein Gewerbegebiet wieder auf einem Radweg zurücklaufen – aber es hat sich gelohnt!

 Es ist früher Sonntagmorgen, als wir von Spechtsbrunn aus über einen Wiesenweg hinauf zum Waldrand steigen. Dort finden wir bald wieder den Kolonnenweg. Und wir finden die Hinweisschilder über junge Menschen, die bei Fluchtversuchen erschossen worden sind. Hier waren es drei Menschen, vor Spechtsbrunn zwei. Abends sagte mir ein Besucher in der Gastwirtschaft: Hier ist nichts passiert. Nur einer ist mal erschossen worden. Das ist alles in Berlin gewesen.“
Es ist früher Sonntagmorgen, als wir von Spechtsbrunn aus über einen Wiesenweg hinauf zum Waldrand steigen. Dort finden wir bald wieder den Kolonnenweg. Und wir finden die Hinweisschilder über junge Menschen, die bei Fluchtversuchen erschossen worden sind. Hier waren es drei Menschen, vor Spechtsbrunn zwei. Abends sagte mir ein Besucher in der Gastwirtschaft: Hier ist nichts passiert. Nur einer ist mal erschossen worden. Das ist alles in Berlin gewesen.“



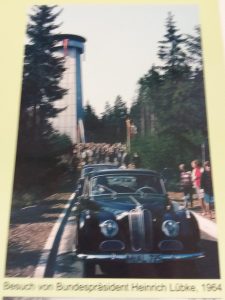



 Überall in den kleine Dörfern links und rechts des Grünen Bandes gab es früher Gasthäuser und Pensionen. Jetzt treffen wir unterwegs kaum auf eine Einkehrmöglichkeit. Häufig findet man am Ortseingang noch ein Hinweisschild mit Öffnungszeiten – aber nur, weil man vergessen hat, es abzumontieren.
Überall in den kleine Dörfern links und rechts des Grünen Bandes gab es früher Gasthäuser und Pensionen. Jetzt treffen wir unterwegs kaum auf eine Einkehrmöglichkeit. Häufig findet man am Ortseingang noch ein Hinweisschild mit Öffnungszeiten – aber nur, weil man vergessen hat, es abzumontieren. In den Gaststätten selbst ist die Zeit stehen geblieben. Das Interieur aus den 60er Jahren, viel Holz, eine Schiebetür für den zweiten Gastraum, alles im Halbdunkel – ich habe sogar den guten alten Kaugummi-Automaten wiederentdeckt. Die Speisekarte stammt auch aus den 60ern: Strammer Max und Toast Hawaii. Frische Klöße gibt es – wenn überhaupt – nur an Wochenenden und auf Bestellung.
In den Gaststätten selbst ist die Zeit stehen geblieben. Das Interieur aus den 60er Jahren, viel Holz, eine Schiebetür für den zweiten Gastraum, alles im Halbdunkel – ich habe sogar den guten alten Kaugummi-Automaten wiederentdeckt. Die Speisekarte stammt auch aus den 60ern: Strammer Max und Toast Hawaii. Frische Klöße gibt es – wenn überhaupt – nur an Wochenenden und auf Bestellung. Das
Das 













